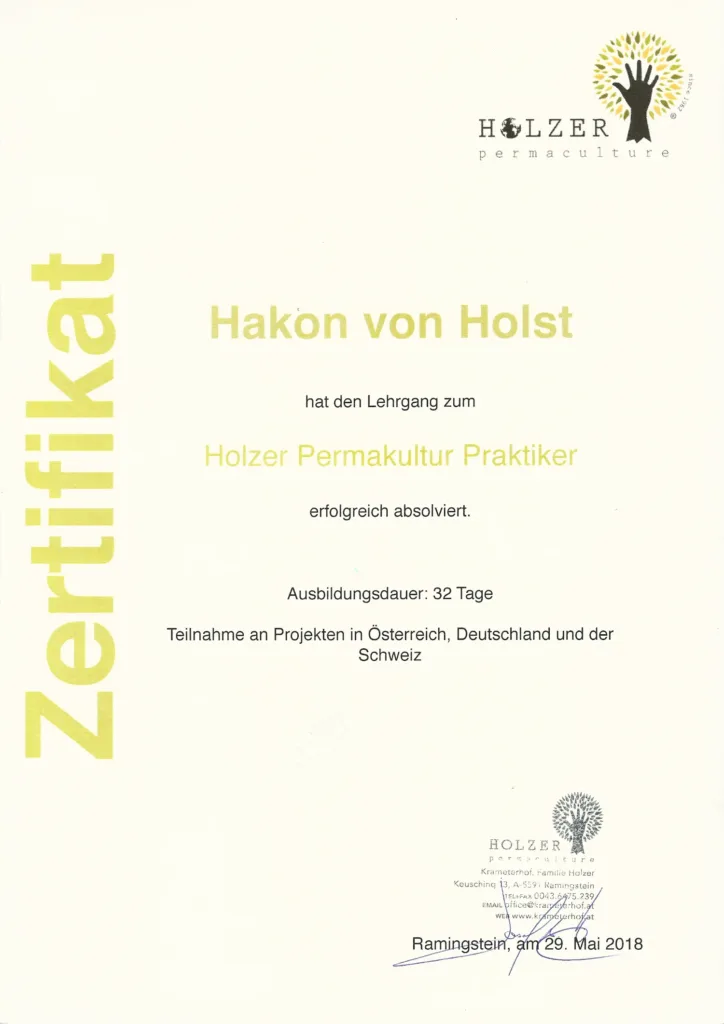Kurz notiert
Bargeld in Europa schützen jetzt: Die Wahlfreiheit, mit Banknoten und Münzen zu bezahlen, droht Stück für Stück zu verschwinden. Zahlreiche Prominente rufen nun zum Schutz des Bargelds auf. Wir haben die Chance, unsere gedruckte Freiheit europaweit abzusichern. Ich bin Co-Initiator. Bitte macht mit und unterschreibt die Petition!
26.07.24, Uferbegrünung kühlt Städte: Stahl und Beton heizen sich auf. Mitunter zehn Grad mehr als im Umland weisen Innenstädte in der Nacht auf, schreibt das Umweltbundesamt. In Berlin gibt es einen Lösungsansatz mit Mehrfachnutzen: Unterwasser-Blumenkübel mit Binsen, Schilf und Lilien beschatten senkrechte Stahlwände am Flussrand. Das kühlt auch das Gewässer selbst. Somit steigt der Sauerstoffgehalt im Wasser und der Fluss wird lebenswerter. Zwischen den Wurzeln der Uferpflanzen finden Fische ein Versteck für ihre Brut. »Käfer, Wespen, Spinnen und Wasserschnecken« siedeln sich an, so der RBB. Nun kehrt sogar der Fischotter zurück.
25.07.24, 164 Pflanzenarten können ohne Wespen nicht überleben: Wespen besitzen einen schlechten Ruf. Nur zwei unter tausenden Vertretern ihrer Art stören den Menschen beim Essen – die Deutsche und die Gemeine Wespe. Eine Literaturstudie zeigt: Wespen sind unverzichtbar. Sie bestäuben 960 Pflanzenarten. 164 davon würden ohne Hilfe der Wespen aussterben. Während einige von ihnen Insekten jagen und so das ökologische Gleichgewicht erhalten, sind andere wiederum Vegetarier: Die Pflanzenwespen besitzen deshalb gar keinen Stachel. In der Landwirtschaft werden Schlupfwespen als Nützlinge eingesetzt. Sie halten zum Beispiel Schädlinge in einem Lager für Hülsenfrüchte im Zaum.
24.07.24, Gesetz gegen Entwaldung auf der Kippe: Die Europäische Volkspartei (EVP) will die Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten aufschieben, berichtet der Deutsche Naturschutzring. Der EVP-Politiker Peter Liese sagt, das Gesetz müsse unbedingt verschoben und die Übergangszeit genutzt werden, um die Regeln zu entbürokratisieren. Der Brief der Biden-Administration zeige die Dringlichkeit, so Liese. Die US-Regierung hatte am 30. Mai 2024 die EU-Kommission aufgefordert, die Verordnung aufzuschieben. Das Gesetz besagt, dass weder Holz noch Kaffee, Kakao, Palmöl, Rindfleisch, Soja oder Druckerzeugnisse in die EU importiert werden dürfen, wenn sie von Flächen stammen, die nach 2020 gerodet wurden, oder wenn sie zur Schädigung von Wäldern führten. Laut Pressemitteilung des EU-Parlaments ist der Verbrauch in der Europäischen Union für 10 Prozent der Waldverluste zwischen 1990 und 2020 verantwortlich.
23.07.24, Alle RKI-Protokolle ungeschwärzt im Internet: Ein Whistleblower aus dem Robert-Koch-Institut bringt sämtliche Corona-Krisenstabsprotokolle aus den Jahren 2020 bis 2023 an die Öffentlichkeit. Dank der Klage des Journalisten Paul Schreyer hatte das RKI bereits einen Teil der Dokumente veröffentlicht, allerdings waren viele Passagen geschwärzt.
22.07.24, Bankkontokündigungen bei Regierungskritikern werden Thema im Mainstream: In der Neuen Osnabrücker Zeitung, im General-Anzeiger und in den Ostfriesischen Nachrichten erscheint eine gekürzte Lizenzversion meiner Recherche zu dem Phänomen der Kontokündigungen bei freien Medien und Publizisten.
20.07.24, Nahwärmeversorgung in Gefahr: »Laut Umfrage wollen über 25 Prozent der Biogasbauern« mit dem Ende der staatlichen EEG-Förderung »ihre Anlagen stilllegen«, berichtet das Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt. Der Fachverband Biogas befürchtet, dass »der bestehende Anlagenpark an verlässlichen erneuerbaren Kraftwerken sukzessive stillgelegt wird, während an anderer Stelle mit Milliardeninvestitionen Gaskraftwerke errichtet werden, die mit fossilem Frackinggas betrieben werden«. Einem Beamten des Landwirtschaftsministeriums zufolge soll die Zukunft der Nahrungsmittelerzeugung gehören anstatt dem Biogas-Mais. Gleichzeitig unterstützt die Regierung den Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen.
19.07.24, Aufruf zum Frieden: Ex-Justizministerin Hertha Däubler-Gmelin, der Historiker Peter Brandt, der Aktivist Reiner Braun und weitere prominente Menschen wenden sich mit einer Petition gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland und eine Kriegsbeteiligung des Landes. Für den 3. Oktober ist eine bundesweite Demonstration geplant.
18.07.24, Presseverbot in Deutschland: Das Innenministerium unterbindet die Herausgabe des Compact-Magazins. Die Zeitschrift wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die Geheimdienstbehörde ist dem handelnden Ministerium unterstellt. Interessant ist die Reaktion von Medien, die sich vom Staat dem Linksextremismus-Vorwurf ausgesetzt sehen oder sahen. So kommentiert die »Junge Welt«: »Unrecht wird nicht Recht, nur weil es mal den Richtigen trifft.« Für Linke seien Verbote gegen rechts deswegen interessant, »weil es sie als nächstes treffen könnte«.
»Neues Deutschland« trägt in einem Bericht kritische Stimmen zusammen. So sehe etwa David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte in dem Verbot einen »Missbrauch des Vereinsrechts«. Darauf hatte die Innenministerin das Verbot der Compact-Betreibergesellschaft juristisch abgestützt. Zudem sei die Verhältnismäßigkeit zweifelhaft, so Werdermann. Es wäre ein milderes Mittel, gegen konkrete Beiträge vorzugehen, wenn sie rechtswidrige oder strafbare Inhalte haben.
Einwurf von mir: Die Innenministerin schrieb auf Twitter, »Compact« agitiere gegen Jüdinnen und Juden. Das könnte die Beamtin in Erklärungsnot bringen, anstatt ihre Entscheidung zu stützen. Sollte der Vorwurf stimmen, hieße das, der Staat hätte jahrelang zugeschaut, anstatt die Verbreitung betroffener Zeitschriftenausgaben zu unterbinden und wegen Volksverhetzung zu ermitteln.
17.07.24, Damit Honigbienen überlebensfähig bleiben: In modernen Wäldern gibt es wenige natürliche Baumhöhlen. Deshalb ist die Honigbiene in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht und in ihrem Überleben vom Menschen abhängig. Da in der Imkerei intensiv ins Bienenleben eingegriffen wird, droht die Biene die Fähigkeit zu verlieren, mit natürlichen Gegebenheiten umzugehen. Auch Nützlinge wie der Bücherskorpion überleben die übliche Säurebehandlung kaum und können in den heutigen Bienenbeuten schlecht existieren. Eine Schweizer Organisation kümmert sich aber darum, dass Honigbienen wieder Baumnester in freier Wildbahn finden.
16.07.24, Amnesty kritisiert Repressionen gegen Proteste in Deutschland: Die Menschenrechtsorganisation dokumentiert in einem aktuellen Bericht Fälle von Polizeigewalt und Einschränkung der Demonstrationsfreiheit.